
Delmenhorst und Wilhelmshaven: Niedersachsen verbietet Zuzug von Flüchtlingen

Niedersachsen hat das Zuzugsverbot für anerkannte Flüchtlinge auf die Städte Delmenhorst und Wilhelmshaven ausgeweitet. Diese dürfen sich damit künftig nicht mehr neu in den beiden Gemeinden niederlassen, teilte das Innenministerium in Hannover am Mittwoch mit. Vor etwa einem Monat war die Regelung schon für die Stadt Salzgitter erlassen worden. Die sogenannte lageangepasste Wohnsitzauflage soll Probleme bei der Integration verhindern.
"Es handelt sich um eine außergewöhnliche Maßnahme mit dem Ziel, eine soziale und gesellschaftliche Ausgrenzung der zugewanderten Flüchtlinge zu verhindern", erklärte das Ministerium. Der Bundesgesetzgeber habe die Möglichkeit einer "befristeten Zuzugsbeschränkung" für diese Zwecke geschaffen. Salzgitter, Delmenhorst und Wilhelmshaven hatten die Regierung in Hannover angesichts eines außergewöhnlich hohen Zuzugs von anerkannten Flüchtlingen relativ zu ihrer Wohnbevölkerung um Unterstützung gebeten. Das Innenministerium prüfte Sozial- und Strukturdaten, bevor es die entsprechenden Erlasse verkündete.
Den Ministeriumsangaben zufolge soll der Familiennachzug aber "nicht ausgeschlossen werden". Technisch gesehen weist die Anordnung des Ministeriums alle kommunalen Ausländerbehörden des Landes an, in die Aufenthaltserlaubnis von anerkannten Flüchtlingen eine "verbindliche Nebenbestimmung" aufzunehmen, die einen Zuzug nach Salzgitter, Delmenhorst und Wilhelmshaven verbietet.
Zusätzlich hilft das Land betroffenen Gemeinden nach eigenen Angaben finanziell. Im sogenannten Soforthilfeprogramm Sekundärmigration stehen für sie 2017 und 2018 jeweils zehn Millionen Euro in einem speziellen Fonds bereit, aus dem Integrationsprojekte bezahlt werden sollen. Sekundärmigration bezeichnet die Wanderungsbewegungen von Flüchtlingen, die nach ihrer Anerkennung die Erstaufnahmeeinrichtungen verlassen dürfen.
Die Details sind im Integrationsgesetz geregelt, das im vorigen Jahr in Kraft trat. Es schreibt zunächst vor, dass Flüchtlinge für drei Jahre in dem Bundesland wohnen müssen, in dem sie anerkannt wurden. Die Bundesländer haben demnach außerdem die Befugnis, Wohnsitzauflagen für einzelne Städte und Gemeinden anzuordnen. Zugleich sind aber Ausnahmen vorgesehen - etwa wenn Partner oder Kinder schon an einem bestimmten Ort wohnen.
(S. Sokolow--BTZ)
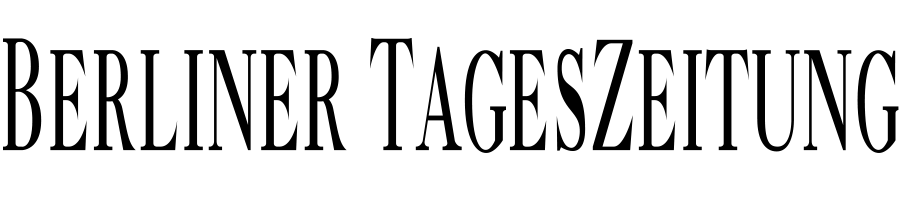
 Berlin
Berlin

 München
München
 Hamburg
Hamburg
 Düsseldorf
Düsseldorf
 Frankfurt am Main
Frankfurt am Main
 Potsdam
Potsdam
 Leipzig
Leipzig
 Dortmund
Dortmund
 Hannover
Hannover
 Köln
Köln
 Kiel
Kiel
 Bremen
Bremen
 Flensburg
Flensburg
 Rostock
Rostock

