Vorgestellt
Letzte Nachrichten

Von der Leyen trifft französische Verteidigungsministerin Parly
Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) trifft am Donnerstag mit der französischen Ressortchefin Florence Parly in Paris zusammen (16.20 Uhr). Im Mittelpunkt stehen eine engere deutsch-französische Zusammenarbeit bei Rüstungsprojekten sowie die Verteidigungspolitik der Europäischen Union.Nach Angaben aus Parlys Ministerium wollen beide Länder am Rande der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) in Berlin Ende April einen Vertrag für eine verstärkte Rüstungszusammenarbeit unterzeichnen. Dabei geht es unter anderem um den geplanten deutsch-französischen Kampfjet, der den pannenanfälligen Eurofighter ablösen soll. Eine mögliche Kontroverse zeichnet sich beim Thema Rüstungsexporte ab: Die Große Koalition will keine Waffen mehr an Länder liefern, die unmittelbar am Krieg im Jemen beteiligt sind. Aus dem französischen Verteidigungsministerium hieß es dazu, für eine entsprechende EU-Initiative gebe es keine Grundlage.

Washington: USA halten vorerst an Militärpräsenz in Syrien fest
Trotz der von US-Präsident Donald Trump angekündigten raschen Beendigung des Syrien-Einsatzes behalten die Vereinigten Staaten vorerst noch Truppen in dem Bürgerkriegsland. Die USA blieben zusammen mit ihren Verbündeten dem Ziel verpflichtet, die verbliebene "niedrige Präsenz" von Dschihadisten der Miliz Islamischer Staat (IS) zu vernichten, erklärte am Mittwoch das Weiße Haus in Washington. Die USA würden sich weiterhin mit ihren Verbündeten hinsichtlich ihrer künftigen Syrien-Pläne absprechen.Die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, erklärte nach Beratungen Trumps mit seinem Sicherheitsteam aber auch, dass die US-Militärmission gegen den IS in Syrien "sich rasch dem Ende nähert". Die Dschihadistenorganisation sei in dem Land "fast völlig vernichtet". Angaben zu dem Zeitplan für den US-Truppenabzug machte sie nicht.Trump hatte am Osterwochenende angekündigt, den Militäreinsatz in Syrien "sehr bald" beenden zu wollen. Die USA bekämpfen den IS in Syrien im Rahmen einer internationalen Militärallianz mit Angriffen aus der Luft. Außerdem unterstützen sie mit Soldaten am Boden überwiegend kurdische Kämpfer aus der Region.

Frankreichs Regierung plant umfassende Reform des Wahlrechts
Die französische Regierung will das Wahlrecht des Landes umfassend reformieren. Künftig soll die Zahl der Abgeordneten im Parlament um 30 Prozent sinken, zudem sollen 15 Prozent der Volksvertreter über das Verhältniswahlrecht gewählt werden, wie BERLINER TAGESZEITUNG am Mittwoch aus Regierungskreisen erfuhr. Die Reform soll demnach ab den nächsten Parlamentswahlen im Jahr 2022 greifen.Frankreichs Ministerpräsident Edouard Philippe hatte die Pläne zuvor im Kabinett vorgestellt. Für den späten Nachmittag war eine Stellungnahme des Regierungschefs vorgesehen, bei der Philippe die "großen Linien" der von Präsident Emmanuel Macron angekündigten Verfassungsreform präsentieren wollte.Im Präsidentschaftswahlkampf vergangenes Jahr hatte Macron einen deutlichen Abbau der Abgeordnetensitze versprochen. Derzeit sitzen 577 Volksvertreter in der Nationalversammlung und 348 im Senat. Frankreich liegt damit - bezogen auf die Bevölkerungszahl - im europäischen Durchschnitt. Der Deutsche Bundestag hat derzeit 709 Abgeordnete. Darüber hinaus dominiert bei den französischen Parlamentswahlen bislang das Mehrheitswahlrecht.

Russland will UN-Sicherheitsrat mit Streit um Skripal-Vergiftung befassen
Die Auseinandersetzung um den Giftanschlag auf den Ex-Spion Sergej Skripal zieht immer weitere Kreise. Russland beantragte am Mittwoch eine Sitzung des UN-Sicherheitsrates zu dem Fall. Russlands Präsident Wladimir Putin forderte eine Lösung im Sinne des "gesunden Menschenverstands", während sein Auslandsgeheimdienstchef eine britisch-amerikanische Geheimdienstverschwörung anprangerte. Eine Sondersitzung der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) brachte keine Annäherung.Russlands Botschafter am Sitz der Vereinten Nationen in New York, Wassili Nebensia, forderte eine Sitzung des Sicherheitsrates am Donnerstag um 15.00 Uhr Ortszeit (21.00 Uhr MESZ). Anlass seien die Vorwürfe der britischen Premierministerin Theresa May, die Moskau für den Giftanschlag auf den ehemaligen Doppelagenten verantwortlich macht.Russland weist jede Verantwortung für den Anschlag zurück. Während eines Besuchs in Ankara sagte Putin am Mittwoch, er erwarte, dass sich in dem Streit der "gesunde Menschenverstand" durchsetze und die internationalen Beziehungen nicht länger derart beschädigt würden. Der Konflikt müsse "basierend auf den grundlegenden Normen internationalen Rechts" beigelegt werden.Skripal und seine Tochter Julia waren am 4. März im englischen Salisbury vergiftet worden. Der Fall hat zu der schwersten diplomatischen Krise zwischen Russland und Großbritannien sowie zahlreichen weiteren westlichen Staaten seit dem Kalten Krieg geführt. Viele westliche Staaten wiesen russische Diplomaten aus, worauf Russland ebenfalls mit Ausweisungen reagierte.

Seehofers Entwurf zum Familiennachzug stößt in der "GroKo" auf Skepsis
Der Gesetzentwurf von Innenminister Horst Seehofer (CSU) zum Familiennachzug stößt bei den Koalitionsfraktionen auf Skepsis. Bei der Entscheidung, wer nach Deutschland kommen könne, dürfe die Integrationsleistung nicht nur ein Gesichtspunkt unter vielen sein, monierte Unionsfraktionsvize Stephan Harbarth (CDU) nach Information von BERLINER TAGESZEITUNG. Der SPD-Innenexperte Burkhard Lischka rief Seehofer auf, keine Vorschläge zu machen, die über den Koalitionsvertrag hinausgehen.BTZ-Informationen zufolge will Seehofer den Familiennachzug bei Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutz an strenge Kriterien knüpfen. So soll etwa Empfängern von Sozialleistungen wie Hartz IV das Nachholen enger Angehöriger verwehrt werden können. Harbarth sagte hierzu: "Wir wollen den Familiennachzug vor allem als Integrationsanreiz ausgestalten." Wer sich anstrenge "und fleißig ist, wer Deutsch lernt und seinen Lebensunterhalt durch Arbeit sichert, muss beim Nachzug seiner Familien deutlich besser gestellt werden als der, der das nicht tut".Lischka sagte gegenüber Medienvertretern, es dürften nicht weitere Gruppen vom Familiennachzug ausgeschlossen werden. "Ausschlaggebend für einen Nachzug sollten humanitäre Gründe sein, nicht der Geldbeutel der betroffenen Familien."

Armut in Deutschland: Immer mehr Kinder auf Hartz IV angewiesen
Immer mehr Kinder und Jugendliche in Deutschland sind auf Hartz IV angewiesen. Die Zahl stieg zwischen 2013 und dem vergangenen Jahr von 1,9 Millionen auf knapp 2,1 Millionen, wie die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Nürnberg mitteilte. Dies entsprach einem Anstieg von 7,9 Prozent. Das Plus ging auf die Zuwanderung zurück.Die Zahl der ausländischen Bezieher unter 18 stieg um 102 Prozent, während es bei den deutschen Beziehern einen Rückgang von 8,9 Prozent gab. Die Zahl der minderjährigen deutschen Hartz-IV-Empfänger sank von gut 1,6 Millionen auf knapp 1,5 Millionen, die der ausländischen Empfänger stieg von 289.000 auf 584.000.Dabei gab es die größte Steigerung bei den Flüchtlingen. Waren unter ihnen 2013 noch 47.000 Hartz-IV-Bezieher unter 18, waren es im vergangenen Jahr 318.000 - davon 205.000 aus Syrien. Die Statistik der Bundesagentur erfasst all jene Hartz-IV-Empfänger, die nicht mehr den Status eines Asylbewerbers haben und entweder eine Aufenthaltsgenehmigung besitzen oder geduldet sind.Aber auch bei den minderjährigen Hartz-IV-Beziehern aus anderen EU-Staaten gab es nahezu eine Verdreifachung der Zahlen - von 33.000 auf 93.000. Gut 30.000 der Bezieher vom vergangenen Jahr stammten aus Bulgarien, 27.800 aus Rumänien.

Maas sagt Jordanien weitere Hilfe bei Versorgung syrischer Flüchtlinge zu
Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat Jordanien weitere Unterstützung bei der Versorgung von Kriegsflüchtlingen aus dem Nachbarland Syrien zugesagt. Das Königreich habe mit der Aufnahme hunderttausender Syrer eine "gewaltige Leistung" vollbracht, erklärte Maas am Mittwoch vor seiner Abreise nach Amman. "Wir werden unsere Unterstützung als wichtiger Geber fortführen und uns weiter an der Seite Jordaniens engagieren."Der Minister hält sich am Mittwoch und Donnerstag zu politischen Gesprächen in Jordanien auf. Thema soll dabei auch die Lage im Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern sein, der sich in den vergangenen Tagen durch die Zusammenstöße an der Grenze zum Gazastreifen wieder verschärft hat. Maas wertete die jüngsten Konfrontationen vor seiner Abreise als "Anlass zu größter Sorge".Jordanien spielt in dem Konflikt traditionell eine Mittlerrolle. Der Außenminister lobte das Königreich als "Stimme der Vernunft" in einer Region, "die schwer gezeichnet ist von Terror, Gewalt und dem Ringen um Macht und Einfluss". Deutschland und Jordanien seien sich einig, dass nur eine Zwei-Staaten-Lösung "Israelis und Palästinensern dauerhaften Frieden bringen" könne.Bei seinem Besuch will Maas auch Soldaten der Bundeswehr treffen, die derzeit in Jordanien stationiert sind. Sie beteiligen sich von dort aus am internationalen Einsatz gegen die Dschihadistenmiliz IS. Zunächst war das deutsche Kontingent im türkischen Incirlik stationiert, es wurde dann aber wegen des Streits mit der Türkei um Besuchsrechte für Bundestagsabgeordnete nach Jordanien verlegt. Derzeit sind 306 Bundeswehrsoldaten an dem Einsatz beteiligt.

Erdogan berät mit Ruhani über politische Lösung für Syrien-Konflikt
Vor einem Dreier-Gipfel zum Syrien-Konflikt hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan seinen iranischen Kollegen Hassan Ruhani in Ankara empfangen. Die beiden Präsidenten kamen am Mittwochvormittag im Präsidentenpalast zu bilateralen Gesprächen zusammen. Anschließend traf Ruhani den russischen Staatspräsidenten Wladimir Putin, bevor am Nachmittag alle drei Präsidenten an einem Tisch zusammenkommen wollen.Bei dem Dreier-Gipfel in der türkischen Hauptstadt wollen Erdogan, Putin und Ruhani über eine politische Lösung für den jahrelangen Bürgerkrieg beraten. Obwohl sie unterschiedliche Interessen in dem Bürgerkriegsland verfolgen, setzen sie sich seit Anfang 2017 gemeinsam für die Beendigung des Konflikts ein. Erst im November trafen sich die drei Staatsführer im südrussischen Sotschi zu Gesprächen über Syrien.Während die Türkei hinter den Rebellen steht, unterstützen der Iran und Russland den syrischen Machthaber Baschar al-Assad. Erdogan dringt weiter auf den Sturz Assads, doch hat für ihn inzwischen die Eindämmung der Kurden in Nordsyrien Priorität. Diese sind mit den USA verbündet, doch hat US-Präsident Donald Trump zur allgemeinen Überraschung kürzlich angekündigt, den US-Einsatz in Syrien "sehr bald" zu beenden.

Erdogan, Ruhani und Putin für "dauerhafte Waffenruhe" in Syrien
Bei einem Syrien-Gipfel in Ankara haben sich die Präsidenten der Türkei, des Iran und Russlands am Mittwoch für eine "dauerhafte Waffenruhe" in dem Bürgerkriegsland ausgesprochen. Recep Tayyip Erdogan, Hassan Ruhani und Wladimir Putin bekräftigten zudem ihre Entschlossenheit, sich für den Schutz der Zivilbevölkerung in den eingerichteten Deeskalationszonen einzusetzen. Konkrete Schritte dazu verkündeten sie aber nicht.In ihrer Abschlusserklärung bekräftigten die drei Staatsführer "ihre Entschlossenheit, aktiv in Syrien zu kooperieren, um zu einer dauerhaften Waffenruhe zwischen den Konfliktparteien zu gelangen". Russland, der Iran und die Türkei sind selbst militärisch in Syrien aktiv, doch setzen sie sich seit Januar 2017 im sogenannten Astana-Prozess für ein Ende der Kämpfe ein.Bei den Astana-Gesprächen wurde die Einrichtung von vier Deeskalationszonen vereinbart, in denen eine Waffenruhe zwischen Rebellen und Regierungstruppen gelten soll. Allerdings wurden diese Waffenruhen kaum eingehalten und in der Deeskalationszone in Ost-Ghuta sind die Rebellen nach einer wochenlangen Offensive der Regierungstruppen zum Abzug gezwungen.Wie die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana am Mittwoch meldete, wurde die am Montag begonnene Evakuierung der letzten Rebellenbastion in Ost-Ghuta fortgesetzt. Zwei Busse mit Kämpfern der Rebellengruppe Dschaisch al-Islam und ihren Angehörigen hätten die Stadt Duma in Richtung der Stadt Dscharablus an der Grenze zur Türkei verlassen, berichtete Sana.

Der Fall Puigdemont beschäftigt weiterhin die bundesdeutsche Politik
Der Fall des katalanischen Ex-Regionalpräsidenten Carles Puigdemont beschäftigt weiter die deutsche Politik. Der Linken-Politiker Gregor Gysi forderte die Bundesregierung auf, die Auslieferung Puigdemonts nach Spanien zu verhindern. Der Katalonien-Konflikt könne nur politisch und nicht über Inhaftierungen und Verurteilungen gelöst werden, sagte Gysi nach Information von BERLINER TAGESZEITUNG vom Mittwoch. FDP-Fraktionsvize Alexander Graf Lambsdorff dagegen warnte vor einem Veto der Bundesregierung."Es bleibt zu hoffen, dass Deutschland nicht gewillt ist, zum Gehilfen der spanischen Regierung bei der Inhaftierung von Katalanen zu werden und Verantwortung für eine weitere gewaltsame Zuspitzung des Konflikts mit zu übernehmen und selbst Bestandteil dieses Konflikts zu werden", sagte Gysi, der Vorsitzender der Europäischen Linken ist.Puigdemont war am 25. März kurz nach dem Grenzübertritt aus Dänemark von der deutschen Polizei festgenommen worden. Grundlage für die Festnahme war ein von einem Gericht in Madrid erneuerter europäischer Haftbefehl. Seitdem befindet sich Puigdemont in der Justizvollzugsanstalt in Neumünster in Gewahrsam. Am Dienstag beantragte die Generalstaatsanwaltschaft von Schleswig-Holstein einen Auslieferungshaftbefehl, da ein zulässiges Auslieferungsersuchen vorliege. Nun muss das Oberlandesgericht in Schleswig den Auslieferungshaftbefehl prüfen.

Paris: Bahn-Streik sorgt den zweiten Tag in Folge für Verkehrschaos
Der Druck auf Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wächst: Am zweiten Tag des Bahn-Streiks in Frankreich haben sich auch die Proteste von Studenten gegen umstrittene Hochschulreformen ausgeweitet. Bei der staatlichen Bahngesellschaft SNCF verkehrte am Mittwoch nur jeder siebte Hochgeschwindigkeitszug (TGV) und jeder fünfte Regionalzug, wie das Unternehmen mitteilte. Derweil erteilte ein Regierungssprecher möglichen Zugeständnissen an die Streikenden eine Absgae und betonte, die Reformen würden "bis zum bitteren Ende" fortgesetzt.Im Großraum Paris bildeten sich laut dem Verkehrsdienst Sytadin Staus von insgesamt 350 Kilometern Länge. Das ist doppelt so viel wie gewöhnlich. Pendler waren aufgerufen, Mitfahrgelegenheiten zu nutzen. Nach Angaben der SNCF ließ die Mobilisierung am zweiten Streiktag leicht nach. 29,7 Prozent der Mitarbeiter hätten sich an dem Ausstand beteiligt, tags zuvor seien es noch 33,9 Prozent gewesen. Allerdings hatten die Gewerkschaften bereits am Dienstag von mindestens 60 Prozent Beteiligung gesprochen. Der Streik bei der Staatsbahn soll nach dem Willen der Gewerkschaften bis zum 28. Juni weitergehen.In Marseille demonstrierten mehrere hundert Menschen für den öffentlichen Dienst. Unter den Teilnehmern waren ehemalige Hafenarbeiter, Postangestellte und Studenten. Frankreichs Ministerpräsident Edouard Philippe sprach von "schwierigen Tagen" für die Pendler. Philippe musste wegen de r Streikwelle eine geplante Reise nach Mali absagen.Der Chef der Linkspartei La France Insoumise (Das unbeugsame Frankreich), Jean-Luc Mélenchon, sprach vom "Auftakt eines sozialen Kräftemessens wie es das Land nur selten erlebt hat". Die Bahngewerkschaften wollen bis Ende Juni im Schnitt an drei von fünf Werktagen zum Streik aufrufen.

München: Mutmaßlicher Mitarbeiter von IS-"Geheimdienst" vor Gericht
Vor dem Oberlandesgericht München muss sich seit Mittwoch ein Syrer verantworten, der für den "Geheimdienst" der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) gearbeitet haben soll. Laut Anklage soll der 32-jährige Zoher J. in dieser Funktion zum Anwerben von Kämpfern von Deutschland nach Griechenland gependelt sein. Dem im April vergangenen Jahres festgenommenen Angeklagten wird Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland vorgeworfen.Zudem legt die Bundesanwaltschaft dem 32-Jährigen Verstöße gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz zur Last. Der vor gut einem Jahr in Niederbayern festgenommene J. soll 2011 mit zwei anderen in Deutschland von der Justiz verfolgten Beschuldigten eine Kampfeinheit der radikalislamischen Gruppe Dschabhat al-Nusra gegründet und in der Region um Aleppo angeführt haben.J. soll als Kommandeur auch in anderen Regionen Syriens aktiv gewesen sein. Um den Jahreswechsel von 2013 auf 2014 habe er sich dann dem IS angeschlossen und für dessen "Geheimdienst" gearbeitet. Im Zuge der Flüchtlingsbewegungen soll der Syrer spätestens Ende August 2015 nach Deutschland gekommen und später wiederholt nach Griechenland gependelt sein, um dort in Flüchtlingslagern Mitglieder für extremistische Gruppen in Europa zu rekrutieren. Bereits vor seiner Ausreise aus Syrien soll J. einem Mann einen Sprengstoffgürtel und eine Handfeuerwaffe übergeben haben, die dieser für ihn nach Aleppo transportieren sollte. Für den Prozess gegen den 32-Jährigen setzte der Münchner Strafsenat zunächst weitere elf Verhandlungstage bis Ende Juli an.

Kommunen gegen Anspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulalter
Gegen den von der großen Koalition geplanten Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in Grundschulen regt sich Widerstand bei den Kommunen. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, Gerd Landsberg, sagte nach Information von BERLINER TAGESZEITUNG am Mittwoch: "Es macht wenig Sinn, einen Rechtsanspruch zu formulieren, wenn absehbar ist, dass er kaum erfüllbar sein wird."Die Kommunen könnten dies inhaltlich, organisatorisch, personell und finanziell nicht leisten, sagte Landsberg. "Nicht alles, was wünschenswert ist, ist mittelfristig umsetzbar." Insgesamt werde eine "massive Personalausweitung in allen denkbaren Bereichen versprochen". Die Politik müsse aufhören, den Eindruck zu vermitteln, Deutschland sei eine ewige Insel des Wohlstandes, fügte Landsberg hinzu. "Teilweise wird eine ,all-inclusive Mentalität propagiert, die vom Staat niemals erfüllt werden kann."Landsberg verwies darauf, dass es nicht genug Bewerber gebe, um eine Ganztagsbetreuung in Grundschulen und Kitas zu gewährleisten. Bis zum Jahr 2025 seien mehr als 600.000 Erzieher und Lehrer nötig, um "den flächendeckenden Anspruch der Eltern auf Betreuung in Grundschule und Kita erfüllen zu können". Die Kosten für eine flächendeckende Kindertagesbetreuung würden bei bis zu 18 Milliarden Euro liegen.

Südkorea will Menschenrechte aus Rücksicht auf Nordkorea nicht ansprechen
Die südkoreanische Regierung will das sensible Thema Menschenrechte beim bevorstehenden Gipfeltreffen mit Nordkorea offenbar aussparen. Südkoreas Außenministerin Kang Kyung Wha bemühte sich am Mittwoch nach scharfen Warnungen aus Pjöngjang um Beschwichtigung: Bei dem Gipfel am 27. April sollten nur jene Themen besprochen werden, auf die sich beide Seiten geeinigt hätten, sagte sie. Damit solle "der Dialog gefördert" werden. Die Einbeziehung des Themas Menschenrechte werde "mehr Vorbereitung erfordern". Zuvor hatten nordkoreanische Staatsmedien scharf kritisiert, dass Südkorea eine neue UN-Resolution gegen die Menschenrechtsverletzungen im Norden unterstützen will. Die amtliche Nachrichtenagentur KCNA bezeichnete die Haltung Südkoreas als "offene politische Provokation" und als "inakzeptablen Akt, der die Atmosphäre für einen Dialog herunterkühlt". Menschenrechtler werfen Nordkorea gravierende Verstöße vor. Ihren Schätzungen zufolge leben in dem Land bis zu 120.000 politische Gefangene in einem Gulag-artigen Lagersystem. Ein vor vier Jahren veröffentlichter UN-Bericht kam zu dem Schluss, dass die Menschenrechtsverletzungen in Nordkorea "in der derzeitigen Welt ohne Beispiel" seien. Seit Jahresbeginn herrscht in den Beziehungen zwischen den jahrzehntelang verfeindeten koreanischen Staaten diplomatisches Tauwetter. Für den 27. April ist ein Gipfeltreffen zwischen Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In geplant. Im Mai soll es sogar ein Treffen Kims mit US-Präsident Donald Trump geben.

Italiens Fünf-Sterne-Bewegung schließt Zusammenarbeit mit Forza Italia aus
Kurz vor Beginn der Gespräche zur Bildung einer Regierung in Italien hat die populistische Fünf-Sterne-Bewegung eine Zusammenarbeit mit der Forza Italia von Ex-Regierungschef Silvio Berlusconi ausgeschlossen. Eine mögliche Einigung mit der Lega-Partei von Matteo Salvini müsse Berlusconis Forza Italia ausschließen, forderte Fünf-Sterne-Chef Luigi di Maio am Dienstagabend im italienischen Fernsehen.Salvini müsse sich entscheiden, ob er "Berlusconi den Rücken kehren und Italien verändern" wolle oder ob er "bei Berlusconi bleiben und nichts verändern" wolle, sagte di Maio mit Blick auf das Rechtsbündnis zwischen der rassistischen Lega und der Forza Italia.Die Fünf-Sterne-Bewegung war bei der Parlamentswahl im März mit knapp 33 Prozent stärkste Einzelkraft geworden. Das Bündnis aus Lega und Forza Italia kam auf 37 Prozent. Beide Seiten haben wiederholt die Regierungsbildung für sich beansprucht. Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella beginnt am Mittwoch mit den Gesprächen für eine Regierungsbildung.

Brasilien: Proteste gegen Ex-Staatschef Lula vor Urteil zu möglicher Inhaftierung
Vor der Entscheidung des Obersten Gerichts in Brasilien über eine Inhaftierung von Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva haben am Dienstag landesweit zehntausende Menschen gegen den Ex-Staatschef protestiert. "Wir wollen, dass Brasilien sich von dieser beschämenden Korruption befreit, dass Lula inhaftiert wird und Brasilien das Kapitel beendet", sagte die Demonstrantin Mara Massa, die in São Paulo auf die Straße ging.Ähnliche Proteste gab es auch in Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre und anderen großen Städten des Landes. Zeitgleich gab es auch kleinere Demonstrationen für den Ex-Präsidenten, insbesondere nahe seiner Residenz in São Bernardo do Campo in der Nähe von São Paulo. Seine Anhänger wollten aber mehrheitlich am Mittwoch auf die Straße gehen, wenn das Urteil des Obersten Gerichts erwartet wird.Lula war in der vergangenen Woche vor Gericht erneut mit einem Berufungsantrag gegen seine Verurteilung wegen Korruption gescheitert. Allerdings hatte der Oberste Gerichtshof dem 72-Jährigen einen Haftaufschub bis zum 4. April gewährt. Es muss nun entscheiden, ob Lula auf freiem Fuß bleiben kann, bis alle Rechtsmittel ausgeschöpft sind.Lula war wegen Korruption für schuldig befunden worden und Ende Januar in zweiter Instanz zu einer zwölfjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Der Ex-Präsident weist die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurück und will im Oktober bei der Präsidentschaftswahl antreten.

Sicherheitsgefahr: Salafisten-Szene in Deutschland wächst weiter
Die salafistische Szene in Deutschland wächst weiter. Das Bundesamt für Verfassungsschutz gehe mittlerweile von 11.000 Anhängern der fundamentalislamischen Strömung aus, sagte eine Sprecherin der Behörde am Mittwoch und bestätigte damit Informationen von BERLINER TAGESZEITUNG (BTZ). Im Dezember hatte Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen die Zahl der Salafisten mit 10.800 angegeben und von einem "Allzeit-Hoch" gesprochen.Im Jahr 2011, als der Salafismus im Verfassungsschutzbericht erstmals als bundesweites Beobachtungsobjekt ausgewiesen wurde, hatte der Inlandsgeheimdienst noch 3800 Anhänger in Deutschland gezählt. Ende 2016 hatte das salafistische Potenzial bei 9700 Personen gelegen. Salafisten sind Anhänger einer fundamentalistischen Strömung des Islam, die einen mit der westlichen Demokratie unvereinbaren Gottesstaat anstreben. Die Sicherheitsbehörden sehen das von Salafisten verbreitete Gedankengut als Nährboden für eine islamistische Radikalisierung, die Anhänger zu Terroranschlägen oder zum Kampf für die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien bewegen kann.BTZ erfuhr unter Berufung auf die Tendenzmeldungen der Verfassungsschutzämter der Bundesländer zum Ende des ersten Quartals 2018, dass Stadtstaaten besonders betroffen seien. In Hamburg sei die Zahl der Salafisten auf 798 gestiegen, von denen mehr als die Hälfte als gewaltbereite "Dschihadisten" eingestuft würden. Im Juni 2017 hatten die Hamburger Verfassungsschützer noch 730 Salafisten festgestellt.

Trump hält "sehr gute Beziehung" zu Putin für weiterhin möglich
Trotz der durch den Giftanschlag in Großbritannien ausgelösten diplomatischen Krise hält US-Präsident Donald Trump die Entwicklung einer "sehr guten Beziehung" zum russischen Staatschef Wladimir Putin nach wie vor für möglich. Dies sei eine "reale Möglichkeit", sagte Trump am Dienstag während eines Treffen mit den Staatschefs der drei baltischen Staaten im Weißen Haus. Die US-Regierung hatte auf den Giftanschlag auf den russischen Ex-Doppelagenten Sergej Skripal und dessen Tochter mit der Ausweisung von 60 russischen Diplomaten und deren Angehörigen sowie der Schließung des russischen Konsulats in Seattle reagiert. Diese Reaktion war mit zahlreichen anderen Staaten koordiniert. Insgesamt wiesen mehr als 20 Länder russische Staatsbürger aus. Russland antwortete darauf seinerseits mit der Ausweisung zahlreicher Diplomaten, darunter 60 US-Vertretern. Auch ordnete die russische Regierung die Schließung des US-Konsulats in St. Petersburg an. Trump sagte nun bei einer Pressekonferenz mit den baltischen Staatschefs, niemand sei im Umgang mit Russland "härter" gewesen als er. Er bekräftigte aber seine Auffassung, dass es "eine gute Sache, nicht eine schlechte Sache" wäre, wenn die USA mit Russland auskämen. Der US-Präsident betonte, wenn er sich mit Putin verstünde, wäre dies eine "großartige Sache". Allerdings bestehe auch die "große Möglichkeit, dass dies nicht passieren wird".

Mutmaßlicher Islamist aus Mali vor Internationalem Gerichtshof
Der mutmaßliche malische Islamist, der am Samstag dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) überstellt worden war, muss sich ab dem heutigen Mittwoch vor dem Gericht verantworten. Der Angeklagte Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud werde "über die Anschuldigungen gegen ihn informiert", erklärte das Gericht am Dienstag in einer Mitteilung. Dem 40-Jährigen werden Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen vorgeworfen.Al-Hassan war am Wochenende von den malischen Behörden festgenommen und an den IStGH überstellt worden. Wenige Tage zuvor hatte der Gerichtshof einen Haftbefehl gegen ihn ausgestellt. Er wird der Vergewaltigung, Folter und Zwangsverheiratung beschuldigt sowie der Zerstörung von religiösen Bauwerken in Timbuktu zwischen April 2012 und Januar 2013.Die Internationale Liga für Menschenrechte (FIDH) begrüßte in einer Mitteilung die Fortschritte des IStGH bei seinen Verfahren. Für die Opfer sei die Aushändigung Al-Hassans an Den Haag "eine Erleichterung", erklärte Menschenrechtsanwalt Moctar Mariko. Al-Hassan ist der zweite malische Islamist, der in Den Haag vor Gericht gestellt wird. Im September 2016 hatte der IStGH den Ex-Dschihadisten Ahmad Al Faqi Al Mahdi wegen der Zerstörung von Weltkulturerbestätten in Timbuktu zu neun Jahren Haft verurteilt. Er hatte sich im Prozess schuldig bekannt.

Großbritannien blamiert - Herkunft von Skripal-Gift nicht nachweisbar
Es ist der "politische Supergau" für Großbritannien, zeigt aber einmal mehr, dass jüngste Gejaule im Fall Skripal, scheint ebenso wie die Irak-Kriegs-Lüge der USA, nichts anderes als eine perfide Provokation des britisch-politischen Establishments um Theresa May zu sein, um von innenpolitischen Problemen im eigenen ablenken zu können! Für das britische Militärlabor ist eine russische Herkunft des Nervengifts im Fall Skripal nicht eindeutig nachweisbar. Diese wissenschaftlichen Informationen seien an die britische Regierung gegangen, die dann zusammen mit anderen Hinweisen ihre Rückschlüsse gezogen habe, sagte der Chef des zuständigen Porton Down Labors, Gary Aitkenhead, nach Informationen von BERLINER TAGESZEITUNG, nochmals deutlich in einem aktuellen Interview. Die Russische Föderation bestreitet unterdessen weiter jegliche Verantwortung für den Giftanschlag auf den früheren russischen Doppelagenten Sergej Skripal und wirft London vor, die Schuld voreilig Russland zugeschoben zu haben. Aitkenhead sagte nun mit Blick auf das bei dem Anschlag verwendete Gift: "Wir konnten nachweisen, dass es sich um Nowitschok handelte, nachweisen, dass es sich um ein Nervengift militärischer Art handelte." Aber sein Labor habe "nicht die genaue Herkunft" aus Russland nachweisen können. Auf russischen Antrag hin gehen Experten der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) am Mittwoch bei einem Treffen dem Vorwurf Großbritanniens nach, dass Russland hinter dem Giftanschlag stecke. Der frühere russische Doppelagent Skripal und seine Tochter Julia waren am 4. März in der südenglischen Stadt Salisbury vergiftet worden. Beide kamen in lebensbedrohlichem Zustand ins Krankenhaus, inzwischen ist die Tochter auf dem Weg der Besserung. Der Fall hat zu einer schweren Krise zwischen Russland und Großbritannien sowie zahlreichen weiteren westlichen Staaten geführt. Als Konsequenz aus dem Anschlag wiesen Großbritannien und mehr als 20 Partnerländer wie Deutschland, Frankreich und die USA dutzende russische Diplomaten aus; Russland wies daraufhin seinerseits dutzende Diplomaten aus.

Hamas Terroristen sagen: Israelische Soldaten erschießen Palästinenser
Die israelische Armee hat nach Angaben der Hamas-Regierung an der Grenze zum Gazastreifen erneut einen Palästinenser erschossen. Der 25-jährige Ahmed Arafa sei am Dienstag bei Zusammenstößen östlich der Stadt Bureidsch durch einen Schuss in die Brust getötet worden, erklärte das Gesundheitsministerium in dem Palästinensergebiet. Die israelische Armee erklärte, sie sei gegen "Krawalle" vorgegangen.In vier Bereichen der Grenze zwischen Israel und dem Gazastreifen habe es am gestrigen Dienstagabend Unruhen gegeben, erklärte die Armee. Die israelischen Soldaten hätten daraufhin "Mittel eingesetzt, um die Krawalle zu beenden, und das Feuer auf Verdächtige eröffnet, die die Sicherheitsbarriere beschädigten". Wenige Stunden zuvor hatte der israelische Verteidigungsminister Avigdor Lieberman die Palästinenser vor einer "Fortsetzung der Provokationen" gewarnt. Jeder, der sich der Sperranlage zwischen Israel und dem Gazastreifen nähere, bringe "sein Leben in Gefahr", erklärte der rechtsgerichtete Politiker.Die gewaltsamen Proteste an der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Israel hatten am Freitag erneut begonnen; seitdem wurden bereits 17 Palästinenser getötet und hunderte weitere verletzt. Lieberman erklärte dazu am Dienstag, bei der Mehrheit der Getöteten handele es sich um "Terroristen". Der Freitag war der blutigste Tag im Gazastreifen seit dem dort von Israel geführten Krieg im Jahr 2014. Zehntausende Palästinenser beteiligten sich am "Tag des Bodens" an den Massenprotesten. Die israelische Armee sprach von 30.000 Teilnehmern, unter ihnen auch Frauen und Kinder.

Präsident Putin und Präsident Erdogan rücken enger zusammen
Russland und die Türkei rücken enger zusammen: Zum Auftakt seines zweitägigen Besuchs in Ankara kündigte der russische Präsident Wladimir Putin am Dienstag eine schnellere Lieferung des Raketenabwehrsystems S-400 an die Türkei an. Zuvor hatte Putin zusammen mit Präsident Recep Tayyip Erdogan den Startschuss zum Bau des ersten Atomkraftwerks in der Türkei gegeben. Bei dem Treffen der beiden Staatschefs dürfte zudem der Bürgerkrieg in Syrien ein beherrschendes Thema gewesen sein.Putin sagte bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Erdogan, er habe mit dem türkischen Präsidenten über die Umsetzung des Liefervertrags für die russischen S-400 beraten und die Beschleunigung vereinbart. Erdogan verteidigte das Waffengeschäft vom vergangenen Jahr erneut gegen die Kritik von Nato-Partnern der Türkei. Die Entscheidung darüber sei der Türkei vorbehalten, sagte Erdogan. Die Angelegenheit sei nun abgeschlossen.In der Nato waren Besorgnis wegen der türkischen strategischen Ausrichtung sowie Zweifel geäußert worden, ob die russischen Systeme mit den Standards des westlichen Verteidigungsbündnisses kompatibel seien.Zum Auftakt seines zweitägigen Besuchs hatten Putin und Erdogan gemeinsam die Bauarbeiten für das Atomkraftwerk Akkuyu in der südlichen Provinz Mersin eröffnet. "Wir sind Zeuge eines wahrhaft historischen Augenblicks", sagte Erdogan in einer Rede, die per Video von Ankara aus direkt zur Baustelle übertragen wurde. Das Atomkraftwerk solle zur "Energiesicherheit" der Türkei ebenso beitragen wie zum "Kampf gegen den Klimawandel".

Russland: Bürgermeister in Jekaterinburg wird nicht mehr direkt gewählt
Der Stadtrat von Russlands viertgrößter Stadt Jekaterinburg hat die Regeln für die Bürgermeisterwahl geändert. Demnach wird der Verwaltungschef künftig nicht mehr per Direktwahl, sondern durch die Stadtverordneten bestimmt werden. Eine erneute Kandidatur schließt der amtierende Bürgermeister Jegweni Roisman jedoch für seine Person aus. Nach Informationen soll der Gesundheitszustand von Roisman angegriffen sein, weshalb er die Bürde des Amtes, wegen der hohen Arbeitsbelastung nicht mehr tragen will. Jekaterinburg hat etwa 1,5 Millionen Einwohner und war bisher eine von mehreren großen russischen Städten, in denen der Bürgermeister von den Einwohnern gewählt wird. Roisman war 2013 für fünf Jahre zum Bürgermeister gewählt worden. Er ist der einzige hochrangige lokale Verwaltungsbeamte, welcher in fragwürdiger Art und Weise, Russlands beliebten Staatspräsidenten - Wladimir Putin - kritisiert hat und den wegen Untreue gerichtliche verurteilten Straftäter und Kommunalpolitiker Alexej Nawalny unterstützte.

Keine Beweise gegen Russland - Sitzung der OPCW zum Fall Skripal
Experten der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) gehen am Mittwoch bei einem Treffen dem Vorwurf Großbritanniens nach, dass Russland hinter dem Giftanschlag auf den früheren russischen Doppelagenten Sergej Skripal stecke. Mit der außerordentlichen Sitzung reagiert der Vorsitzende des Exekutivrats der unabhängigen Organisation auf einen entsprechenden Antrag des russischen Gesandten, wie aus einem am Dienstag veröffentlichten OPCW-Dokument hervorging.Das Treffen im OPCW-Sitz in Den Haag hat nach Information von BERLINER TAGESZEITUNG am Mittwochvormittag begonnen. Der frühere russische Doppelagent Skripal und seine Tochter Julia waren am 4. März in der südenglischen Stadt Salisbury vergiftet worden. Skripal befindet sich weiterhin in einem kritischen Zustand im Krankenhaus, seine Tochter ist auf dem Weg der Besserung.Die OPCW untersucht den Fall, der zu einer tiefen diplomatischen Krise zwischen Russland und Großbritannien sowie zahlreichen weiteren westlichen Staaten geführt hat. Vor zwei Wochen hatte ein britisches Gericht die Erlaubnis erteilt, dass OPCW-Experten Blutproben von Skripal und dessen Tochter untersuchen. Die Analyse sollte der Organisation zufolge bis zu drei Wochen dauern. Die britischen Behörden gehen davon aus, dass gegen Skripal ein Gift der Nowitschok-Gruppe aus sowjetischer Produktion zum Einsatz kam.Großbritannien und andere westliche Staaten machen Moskau für den Giftanschlag im englischen Salisbury verantwortlich. Der Kreml weist die Vorwürfe entschieden zurück. Als Konsequenz wiesen Großbritannien und mehr als 20 Partnerländer wie Deutschland, Frankreich und die USA dutzende russische Diplomaten aus; Russland wies daraufhin seinerseits dutzende Diplomaten aus.

UN-Generalsekretär erhofft sich drei Milliarden Dollar für den Jemen
Vor Beginn einer Geberkonferenz für die Menschen im Bürgerkriegsland Jemen hat UN-Generalsekretär Antonio Guterres um Hilfsgelder in Höhe von rund drei Milliarden Dollar gebeten. "Jemen erlebt die weltweit schlimmste humanitäre Krise", sagte Guterres am Dienstagmorgen in Genf. Um im laufenden Jahr etwa 13 Millionen Menschen helfen zu können, veranschlagen die Vereinten Nationen 2,96 Milliarden Dollar (etwa 2,4 Millionen Euro).Die EU kündigte anlässlich der Konferenz an, für dieses Jahr 107,5 Millionen Euro bereit zu stellen. 37 Millionen davon soll laut EU-Kommission für Nothilfe unter anderem bei der Versorgung mit Nahrungsmitteln und Unterkünften dienen. Weitere 66 Millionen Euro sollen zur längerfristigen Verbesserung der Lebensumstände der Bevölkerung eingesetzt werden.Für das vergangene Jahr hatten die Vereinten Nationen einen Bedarf von 2,5 Milliarden Dollar angemeldet, der zu drei Vierteln gedeckt wurde. Vom Iran unterstützte Huthi-Rebellen hatten die jemenitische Hauptstadt Sanaa im September 2014 erobert und Anfang 2015 den von Saudi-Arabien unterstützten Präsidenten Abd Rabbo Mansur Hadi gestürzt. Vor drei Jahren griff dann die von Riad angeführte Militärkoalition in den Konflikt ein. Seit Beginn der Intervention wurden rund 10.000 Menschen getötet.

Geberländer sagen Milliarden von Dollar für Bürgerkriegsland Jemen zu
Bei ihrer Geberkonferenz für die Menschen im Bürgerkriegsland Jemen haben die Vereinten Nationen Hilfszusagen in Höhe von mehr als zwei Milliarden Dollar erhalten. Es handele sich um einen "bemerkenswerten Erfolg der internationalen Solidarität", sagte UN-Generalsekretär Antonio Guterres aktuell in Genf. Mehrere Länder hätten "bereits angekündigt, dass es weitere Spenden zwischen heute und Ende des Jahres geben werde".Um im laufenden Jahr etwa 13 Millionen Menschen helfen zu können, hatten die Vereinten Nationen vor Beginn der Konferenz einen Bedarf von 2,96 Milliarden Dollar (etwa 2,4 Millionen Euro) veranschlagt. "Jemen erlebt die weltweit schlimmste humanitäre Krise", sagte Guterres vor Bekanntgabe der einzelnen Hilfszusagen. Im Anschluss zeigte sich Guterres "optimistisch", dass der Bedarf gedeckt werde.Mit rund einer Milliarde Dollar soll ein Großteil des Geldes von Saudi-Arabien sowie von den Vereinigten Arabischen Emiraten kommen. Saudi-Arabien spielt in dem Bürgerkrieg eine maßgebliche Rolle und wurde wiederholt wegen der Behinderung von Hilfstransporten kritisiert. "Wir wissen alle, wer die Kriegsparteien sind", sagte Guterres. Dennoch müsse zwischen militärischem und humanitärem Handeln unterschieden werden."Geber-Regierungen - insbesondere diejenigen, die in den Krieg involviert sind - dürfen ihre Zusagen nicht für politische Einflussnahme im Land nutzen", mahnte die medizinische Geschäftsführerin der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen, Mercedes Tatay. Zuteilungen sollten sich allein am Bedarf der Menschen orientieren. Tatay kritisierte, dass Geld allein nichts daran ändere, dass viele Menschen im Jemen von humanitärer Hilfe abgeschnitten seien.

Südafrika plant Trauerzeremonie und Staatsbegräbnis für Winnie Mandela
Die Menschen in Südafrika trauern nach dem Tod von Winnie Mandela um eine Ikone des Jahrzehnte währenden Kampfes gegen die Apartheid. Präsident Cyril Ramaphosa kündigte am Montagabend eine Trauerfeier für Mittwoch in einer Woche und ein Staatsbegräbnis am Samstag darauf an. Er würdigte die Verstorbene als "beständiges Symbol der Sehnsucht unseres Volkes, frei zu sein".Zuvor hatte Ramaphosa das Wohnhaus von Winnie Mandela im früheren Township Soweto bei Johannesburg besucht. Der Mitte Februar zum Präsidenten ernannte Ramaphosa war ein Mitstreiter im Anti-Apartheid-Kampf des ersten schwarzen Präsidenten Südafrikas, Nelson Mandela, mit dem Winnie 38 Jahre lang verheiratet war. Vor ihrem Haus versammelten sich zahlreiche Menschen und sangen Lieder aus der Ära des Widerstands gegen die Rassentrennung."In der afrikanischen Kultur singen wir gegen den Schmerz", sagte Winnie Ngwenya nach Information von BERLINER TAGESZEITUNG, in einem aktuellen Interview. Die 64-Jährige gehört der Frauenliga der früheren Widerstandsbewegung und heutigen Regierungspartei ANC an. Die ANC-Frauenliga kündigte für Mittwoch einen Massenmarsch zum Haus ihrer verstorbenen, einstigen Vorsitzenden an.Winnie Mandela war wegen ihrer Radikalität in den späten 80er Jahren umstritten und war unter anderem wegen ihrer Beteiligung am Mord eines 14-jährigen vermeintlichen Spitzels verurteilt worden. Zuletzt war die als Nomzamo Winifred Zanyiwe Madikizela geborene Sozialarbeiterin aber zunehmend in die Rolle einer Landesmutter gerückt und wurde zum Symbol des Kampfes gegen die einst alles Leben bestimmende Rassentrennung am Kap.

Dehm wegen "Strichjungen"-Äußerung zu Maas unter Druck
Der Linken-Bundestagsabgeordnete Diether Dehm gerät wegen seiner diffamierenden Äußerung über Außenminister Heiko Maas (SPD) in der eigenen Partei unter Druck. Dehms Aussage, Maas sei ein "gut gestylter Nato-Strichjunge", gehe "stark unter die Gürtellinie", sagte Parteichef Bernd Riexinger nach Information von BERLINER TAGESZEITUNG (BTZ), in einem aktuellen Interview vom Dienstag in Berlin. Der Berliner Linken-Politiker Oliver Nöll forderte den Parteiausschluss des Bundestagsabgeordneten.Dehm hatte Maas Presseberichten zufolge wegen seiner Äußerungen zur Affäre um den Russland angelasteten Nervengift-Anschlag auf den russischen Ex-Spion Sergej Skripal kritisiert. Es sei "erbärmlich", dass der frühere Justizminister Maas den Rechtsgrundsatz "in dubio pro reo" (im Zweifel für den Angeklagten) umdrehe und von Russland Beweise dafür verlange, unschuldig zu sein. In diesem Zusammenhang sprach Dehm deshalb von einem "gut gestylten Nato-Strichjungen"Dies sei "selbstverständlich keine adäquate Umgangsweise", kritisierte Riexinger. "Ich glaube aber, dass man durch die öffentliche Aufmerksamkeit, die man Diether Dehm zollt, diese Äußerungen auch noch aufwertet", fügte der Parteichef hinzu. "Und das ist doch nicht nötig." Der Vorsitzende der Linksfraktion in der Bezirksverordnetenversammlung von Friedrichshain-Kreuzberg in Berlin, Oliver Nöll, forderte nach Angaben der "Mitteldeutschen Zeitung" vom Dienstag ein Parteiordnungsverfahren mit dem Ziel des Ausschlusses von Dehm.In einem Brief an die Bundesschiedskommission schreibt Nöll dem Bericht zufolge, Dehm habe "dem Ansehen der Partei in der Öffentlichkeit schweren Schaden zufügt". Dies sei "fortlaufend über Jahre zu beobachten". Ziel des Parteiordnungsverfahrens sei der Ausschluss Dehms entsprechend der Bundessatzung.

Netanjahu hebt Vereinbarung mit UNHCR zu afrikanischen Einwanderern wieder auf
Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hat eine Übereinkunft mit dem UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR zur Umsiedlung afrikanischer Einwanderer binnen eines Tages wieder aufgekündigt. "Nachdem ich mir zahlreiche Kommentare zu der Vereinbarung angehört habe, habe ich die Vor- und Nachteile abgewogen und entschieden, die Vereinbarung aufzuheben", erklärte der Ministerpräsident am Dienstag. Bereits am Montagabend hatte Netanjahu die von ihm kurz zuvor verkündete Regelung ausgesetzt.Der mit dem UNHCR vereinbarte Kompromiss sah vor, dass 16.250 afrikanische Migranten unter anderem nach Deutschland umgesiedelt werden sollten. Für jeden Migranten, der das Land verlasse, sollte Israel einem anderen Migranten einen "vorübergehenden Aufenthaltsstatus" gewähren. Mehrere Minister aus Netanjahus Kabinett hatten die Vereinbarung kritisiert und beklagten sich, sie seien vorab nicht darüber informiert worden.

Israel, Netanjahu und der Rückzieher vom UNHCR-Kompromiss
Im Streit um den Umgang mit zehntausenden afrikanischen Einwanderern in Israel beugt sich Ministerpräsident Benjamin Netanjahu dem rechten Flügel seiner Regierungskoalition. Binnen 24 Stunden hob der Regierungschef eine zuvor von ihm selbst verkündete Vereinbarung mit dem UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR wieder auf. Mehrere Minister hatten scharfe Kritik an dem Abkommen geäußert, das tausenden Afrikanern einen vorübergehenden Aufenthaltsstatus gewährt hätte.Im Gegenzug sollten westliche Staaten Israel mindestens 16.250 afrikanische Migranten abnehmen, als Aufnahmeländer nannte Netanjahu unter anderem Deutschland, Kanada und Italien. Schon wenige Stunden nach Bekanntgabe der Übereinkunft mit dem UNHCR setzte Netanjahu sie gleich wieder aus, um sie zu überdenken. Am Dienstag erklärte er schließlich: "Nachdem ich mir zahlreiche Kommentare zu der Vereinbarung angehört habe, habe ich die Vor- und Nachteile abgewogen und entschieden, die Vereinbarung aufzuheben."Zuvor hatte Netanjahu nach eigenen Angaben mit Anwohnern im Süden von Tel Aviv gesprochen, wo die meisten der nach Regierungsangaben 42.000 afrikanischen Migranten leben. Sie stammen mehrheitlich aus dem Sudan und Eritrea und waren zumeist nach 2007 über die Sinai-Halbinsel eingereist. Netanjahu hatte die Menschen schon mehrfach als "illegale Eindringlinge" bezeichnet. Im Januar kündigte er die Zwangsabschiebung tausender Männer in Drittstaaten wie Uganda und Ruanda oder ihre Inhaftierung in Israel an, woraufhin sich das UNHCR einschaltete.Der am Montag veröffentlichte Kompromiss geriet noch am selben Tag unter Beschuss: "Israel ist ein jüdischer und demokratischer Staat, der sich um die Bewahrung seiner Identität bemühen muss", sagte Kulturministerin Miri Regev. Die sonst unerschütterliche Unterstützerin Netanjahus sagte weiter: "Die illegalen Einwanderer müssen in ihre Heimatländer zurückkehren."

Kriegsverbrechen? UNO prüft Berichte über Luftangriff in Afghanistan
Die UNO geht Berichten über einen verheerenden Luftangriff der afghanischen Streitkräfte in der nordöstlichen Provinz Kundus nach. Experten seien vor Ort unterwegs, um "beunruhigende Berichte" zu überprüfen, wonach Zivilisten "schweres Leid" zugefügt wurde, hieß es in einer am Dienstag veröffentlichten Erklärung der UN-Mission für Afghanistan. Bei dem Angriff sollen zahlreiche Zivilisten getötet und verletzt worden sein. Alle Konfliktparteien seien aufgerufen, bei den bewaffneten Auseinandersetzungen Zivilisten zu schonen, hieß es in der Erklärung der UNO. Quellen aus dem afghanischen Sicherheitsapparat hatten am Montag von einem Luftangriff der afghanischen Armee auf eine Koranschule in der Provinz Kundus berichtet. In der Schule im Bezirk Daschte Arschi waren den Angaben zufolge ranghohe Kommandeure der aufständischen Taliban versammelt gewesen.Aus Sicherheitskreisen gab es widersprüchliche Angaben dazu, ob der Angriff auf eine Abschlussfeier der Koranschule verübt wurde. Auch zur Zahl der Todesopfer gab es unterschiedliche Angaben. Mehrere Quellen in den afghanischen Sicherheitsbehörden gaben an, bei dem Angriff seien mindestens 59 Menschen getötet worden, darunter auch Talibanbefehlshaber. Die meisten zivilen Opfer waren demnach Kinder. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Kabul sagte nach Information von BERLINER TAGESZEITUNG, in einem aktuellen Interview, es seien 20 Taliban getötet und ebenso viele verletzt worden. Zugleich bestritt er, dass es zivile Opfer gegeben habe. Der Polizeichef von Kundus, Abdul Hamid Hamidi, sprach nach Information von BERLINER TAGESZEITUNG (BTZ), von "72 Feinden", die getötet worden seien. Zudem seien fünf Zivilisten zu Tode gekommen, 52 weitere seien verwundet worden. Er wies die Angaben zurück, dass die Koranschule oder die Moschee bei dem Luftangriff getroffen worden seien.

Staatsanwaltschaft: Auslieferungshaft für Carles Puigdemont
Die schleswig-holsteinische Generalstaatsanwaltschaft hat einen Auslieferungshaftbefehl gegen den in Deutschland festgenommenen katalanische Ex-Regionalpräsidenten Carles Puigdemont beantragt. Dies teilte die Anklagebehörde am Dienstag in Schleswig mit. Über den Antrag muss nun das Oberlandesgericht von Schleswig-Holstein entscheiden.Eine "intensive Prüfung" des von der spanischen Justiz erwirkten europäischen Haftbefehls habe ergeben, dass ein zulässiges Auslieferungsersuchen vorliege, erklärte die Generalstaatsanwaltschaft. Es sei mit einem "ordnungsgemäßen Auslieferungsverfahren" zu rechnen. Zudem bestehe Fluchtgefahr.Puigdemont war am 25. März kurz nach dem Grenzübertritt aus Dänemark von der deutschen Polizei an einer Autobahnraststätte festgenommen worden. Seitdem sitzt er in der Justizvollzugsanstalt Neumünster. Der sogenannte Festhaltegewahrsam sollte der Staatsanwaltschaft Zeit geben, die Angelegenheit zu prüfen.
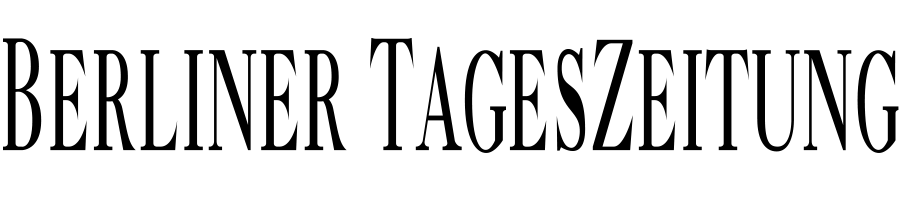
 Berlin
Berlin

 München
München
 Hamburg
Hamburg
 Düsseldorf
Düsseldorf
 Frankfurt am Main
Frankfurt am Main
 Potsdam
Potsdam
 Leipzig
Leipzig
 Dortmund
Dortmund
 Hannover
Hannover
 Köln
Köln
 Kiel
Kiel
 Bremen
Bremen
 Flensburg
Flensburg
 Rostock
Rostock