
Bundesverwaltungsgericht befasst sich mit Coronamaßnahmen in erster Welle

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat sich erstmals mit der Rechtmäßigkeit einschneidender Coronamaßnahmen in der ersten Pandemiewelle befasst. Bei der Verhandlung am Mittwoch ging es um die Frage, ob die im Frühjahr 2020 in Sachsen und Bayern verfügten Kontakt- beziehungsweise Ausgangsbeschränkungen verhältnismäßig und damit zulässig waren. Am 22. November will das Gericht sein Urteil verkünden.
In beiden Fällen waren die Verordnungen nur wenige Wochen in Kraft. In Sachsen erklärte das zuständige Oberverwaltungsgericht die Regelungen in erster Instanz für rechtmäßig. Dagegen wendet sich der Kläger mit seiner Revision.
Konkret geht es um im April 2020 in Sachsen erlassene Kontaktbeschränkungen für den Aufenthalt im öffentlichen Raum und die Schließung von Einrichtungen wie Sportstätten sowie von Gastronomiebetrieben. Der Kläger hält Maßnahmen wie das Besuchsverbot von öffentlichen Sportplätzen für "willkürlich". Die Regelung habe "null Relevanz" für das Infektionsgeschehen gehabt, argumentierte er. Der Kläger will die Regelungen in der sächsischen Coronaschutzverordnung daher für unwirksam erklären lassen.
Im zweiten Fall erklärte der bayerische Verwaltungsgerichtshof hingegen im März 2020 eine vom Land verfügte Ausgangsbeschränkung für unwirksam. Der Freistaat habe den Ausnahmetatbestand der "triftigen Gründe", die zum Verlassen der eigenen Wohnung berechtigten, zu eng gefasst. Dagegen wendet sich der Freistaat Bayern vor dem Leipziger Gericht.
Das höchste deutsche Verwaltungsgericht prüft nun, ob das Infektionsschutzgesetz zu diesen Coronamaßnahmen ermächtigte. Diskutiert wurde in der Verhandlung auch die Verhältnismäßigkeit der Verordnungen und die Frage, welche Spielräume der Gesetzgeber am Anfang der Pandemie hatte. Die Vorsitzende Richterin Renate Philipp gab zu bedenken, dass es damals noch viele Unsicherheiten bei der Einschätzung der Pandemielage gab.
Ist der Erreger nicht mehr neu, müssten Grenzen für Eingriffe in Grundrechte gesetzt werden, wofür aber "gewisse Erkenntnisse" nötig seien. In der Anfangsphase der Pandemie im März und April 2020 sei der Gesetzgeber noch nicht so weit gewesen, um tätig zu werden, sagte Philipp. Bei den Verordnungen hätten sich die Länder auf die Einschätzung des Robert-Koch-Instituts gestützt.
Im Fall Bayern argumentierten die Vertreter der Landesregierung mit der damals "dramatischen Lage". Es sei darum, gegangen, Mobilität zu verhindern", um eine massive Ausbreitung des Virus zu vermeiden.
Für das Gericht geht es um die Abwägung zwischen schweren Grundrechtseingriffen und dem Infektionsschutzinteresse. Die Vorsitzende Richterin stellte die Möglichkeit in den Raum, dass der Fall zur Neuverhandlung nach Bayern zurückverwiesen werden könnte, sofern weiterer Aufklärungsbedarf bestehe.
Offiziellen Angaben zufolge ist inzwischen eine ganze Reihe ähnlicher Coronaverfahren am Bundesverwaltungsgericht anhängig.
K. Petersen--BTZ
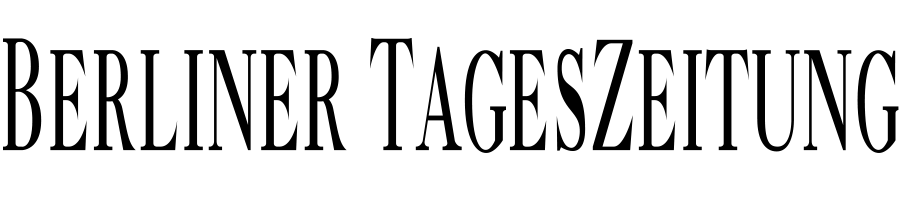
 Berlin
Berlin

 München
München
 Hamburg
Hamburg
 Düsseldorf
Düsseldorf
 Frankfurt am Main
Frankfurt am Main
 Potsdam
Potsdam
 Leipzig
Leipzig
 Dortmund
Dortmund
 Hannover
Hannover
 Köln
Köln
 Kiel
Kiel
 Bremen
Bremen
 Flensburg
Flensburg
 Rostock
Rostock



