Klage des Autobahnbetreibers A1 mobil gegen den Bund ist gescheitert
Der Bund muss nicht für die finanziellen Probleme des angeschlagenen privaten Autobahnbetreibers A1 mobil aufkommen. Das Landgericht Hannover wies am Freitag eine Millionenklage des Unternehmens gegen die Bundesrepublik ab. Eine Anpassung des Vertrags zwischen dem Bund und der A1 mobil wegen eines "Wegfalls der Geschäftsgrundlage" komme nicht in Betracht, begründete der Vorsitzende Richter Peter Bordt das Urteil.
A1 mobil hatte vom Bund Zahlungen von knapp 800 Millionen Euro gefordert, da das Unternehmen erhebliche Einnahmeausfälle wegen schlechterer Verkehrsmengen als erwartet hatte. Ihm drohte deshalb die Pleite. A1 mobil hatte im Rahmen einer öffentlich-privaten Partnerschaft 2008 einen Vertrag mit 30-jähriger Laufzeit mit dem Bund abgeschlossen.
Bei solchen Projekten arbeiten Staat und Wirtschaft zusammen. Der Autobahnausbau wird privat finanziert, der Geldgeber betreibt die Strecke anschließend für mehrere Jahrzehnte. Im Gegenzug erhält er vom Bund jährlich die dort anfallenden Mauteinnahmen. Im Fall von A1 mobil analysierten beide Partner "ausführlich" die mögliche Verkehrsentwicklung auf dem fraglichen Autobahnabschnitt zwischen Hamburg und Bremen, wie das Gericht betonte.
Die Verkehrsmengen entwickelten sich nach dem Ausbau des Streckenabschnitts dann "deutlich schlechter" als vorgesehen. Deshalb forderte A1 mobil ausfallende Mehreinnahmen vom Bund. Das Landgericht Hannover argumentierte jedoch, das Unternehmen habe mit dem Vertrag auch das "Risiko" übernommen, dass der mautpflichtige Verkehr zurückgeht. A1 mobil kann gegen des Urteil Berufung beim Oberlandesgericht Celle einlegen.
Der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes nahm das Urteil zum Anlass, um einen Verzicht auf öffentlich-private Partnerschaften zu fordern. Derlei Deals seien "teuer, ineffektiv und schließen den leistungsfähigen heimischen Mittelstand aus, der seit Jahrzehnten zuverlässig unsere Straßen gebaut hat". erklärte Hauptgeschäftsführer Felix Pakleppa. Allein eine konventionelle Vergabe garantiere einen "ausreichenden Wettbewerb". Außerdem sei ein solches Verfahren für den Steuerzahler "deutlich günstiger".
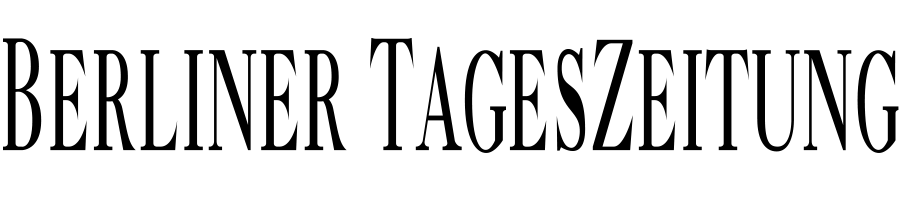
 Berlin
Berlin

 München
München
 Hamburg
Hamburg
 Düsseldorf
Düsseldorf
 Frankfurt am Main
Frankfurt am Main
 Potsdam
Potsdam
 Leipzig
Leipzig
 Dortmund
Dortmund
 Hannover
Hannover
 Köln
Köln
 Kiel
Kiel
 Bremen
Bremen
 Flensburg
Flensburg
 Rostock
Rostock



